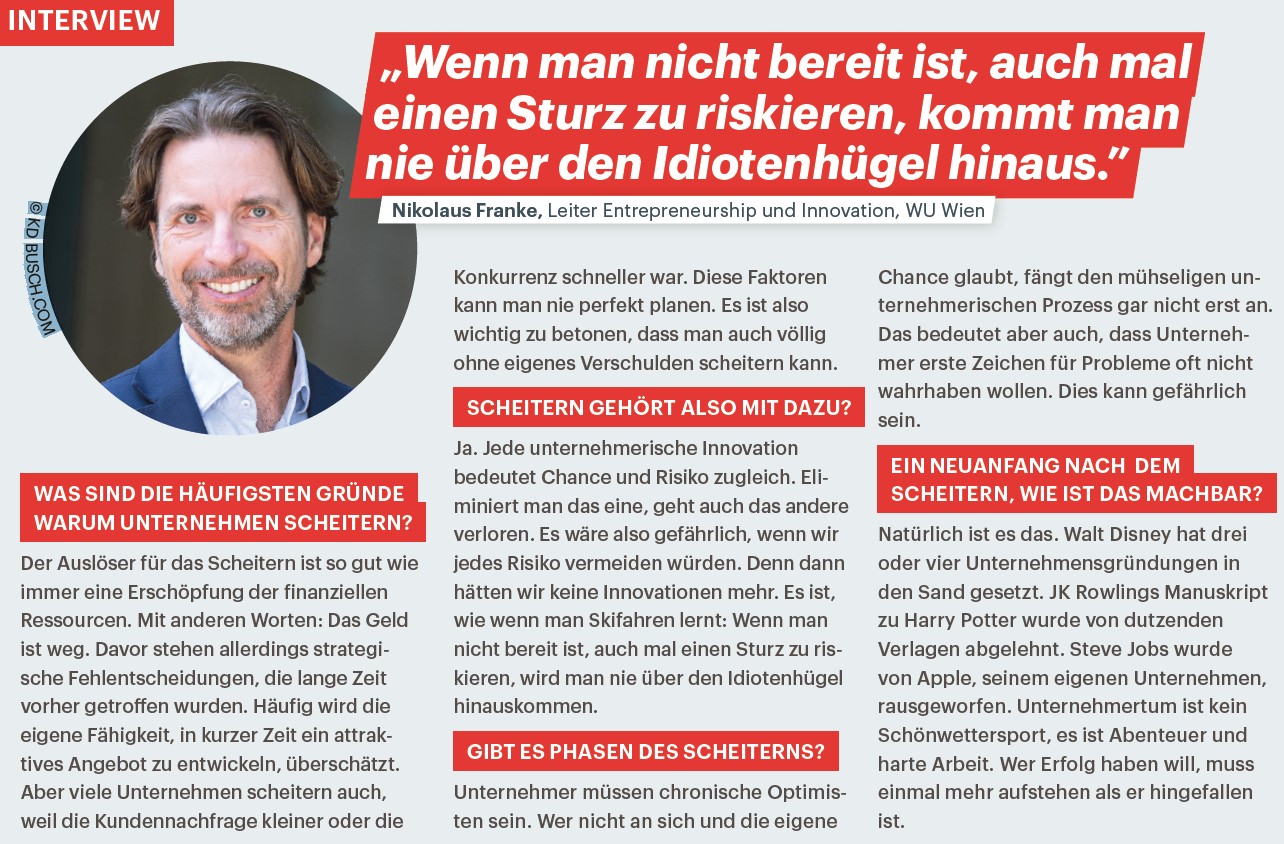Vom Fallen und wieder Hochklettern
Wer in Österreich als Unternehmer scheitert, gilt oft als Versager. Ein innovationsfeindlicher Ansatz, der davon abhält, stattdessen aus Fehlern zu lernen und es neu zu probieren.
Lesedauer: 5 Minuten
Thomas Alva Edison entwickelte die Glühbirne bis zur Patentreife und benötigte dafür im Vorfeld zig Versuche, die allesamt daneben gingen. Nach 1000 fehlerhaften Versuchen soll er auf ein Scheitern des Projektes angesprochen worden sein. „Ich bin nicht gescheitert. Ich kenne jetzt 1000 Wege, wie man keine Glühbirne baut”, soll Edison erwidert haben. Ein völlig richtiger Zugang, wie die Junge Wirtschaft Wien (JWW) befindet. Als größtes Netzwerk für Jungunternehmerinnen und -unternehmer verortet man die negative Kultur des Scheiterns als Hemmschuh für Gründungen und Innovationen. Denn sich entmutigen zu lassen, ist nicht nur eine weitere persönlich schmerzhafte Erfahrung – schließlich scheitert niemand aus freien Stücken. Vielmehr bedeutet es auch ein Defizit für Wirtschaft und Gesellschaft, da neue Unternehmen sich womöglich erst gar nicht an den Start wagen und Innovationen so auf der Strecke bleiben, wie die Forschung betont
Unternehmerisches Scheitern zu stigmatisieren ist falsch, weil es Mut nimmt und hemmt.

Walter Ruck
Präsident der Wirtschaftskammer Wien
Denn Scheitern gehört zum Leben – und macht daher auch vor wirtschaftlichen Unternehmungen nicht halt. In der breiten Gesellschaft stößt dies jedoch auf ein Tabu. Dazu Walter Ruck, Präsident der WK Wien: „Auch wenn die USA derzeit vor allem durch abstruse Wirtschaftspolitik auffallen, können wir uns dennoch etwas von ihnen abschauen: Ihren Zugang zum Unternehmertum. Dort bedeutet unternehmerisches Scheitern eine Erfahrung und den Beginn einer neuen Geschäftsidee – und nicht das gesellschaftliche Abseits“, beschreibt Ruck. In dasselbe Horn bläst mit Clemens Schmidgruber auch der Vorsitzende der JWW: „Viele amerikanische Venture Capital Fonds investieren ausschließlich in Gründer, die mindestens ein- oder zweimal gescheitert sind – weil sie wissen, wie enorm viel Gründer aus ihren Fehlern lernen. Ein bisschen von diesem Mindset würde uns in Österreich unheimlich guttun.”
Positive Fehlerkultur
Daher setzt sich die JWW mit Forderungen für eine positivere Fehlerkultur hierzulande ein. Zudem gibt es Kooperationen mit Stakeholdern wie etwa den sogenannten Fuckup-Nights. Hier kommen Wirtschaftstreibende zu Wort, die die schmerzhafte Erfahrung des Scheiterns bereits gemacht haben. Sich Fehler einzugestehen und offen darüber zu sprechen, sei essenziell, ist Dejan Stojanovic, Gründer und Organisator der Fuckup-Nights in Österreich, überzeugt. Entscheidend ist dies nicht nur für den individuellen Lernprozess, sondern auch, um die gesellschaftliche und wirtschaftliche Relevanz eines konstruktiven Umgangs mit Fehlern weiter zu stärken. Das ist letztlich der Schlüssel zu nachhaltigem Fortschritt und langfristigem Erfolg”, so Stojanovic.
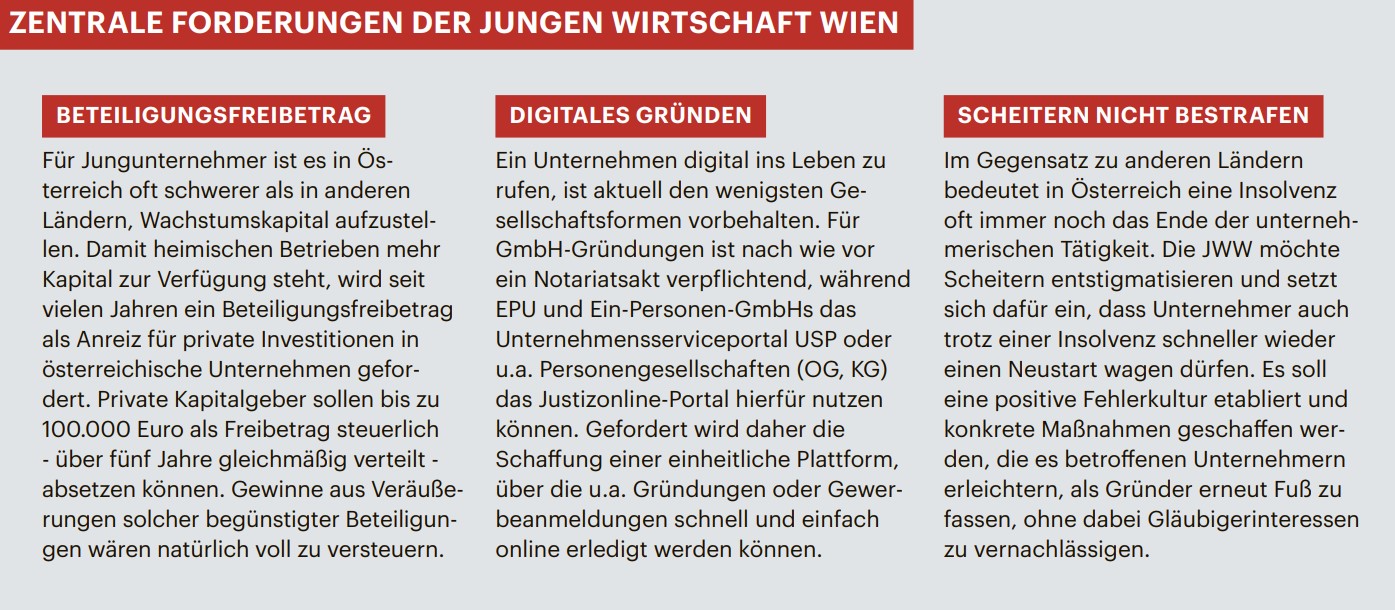
Die zweite Chance nutzen
Was Rückschläge bedeuten, weiß Anna Abermann nur zu gut. Mit ihrer Bio-Getränkemarke Pona feierte sie 2014 erste Erfolge, im Sommer 2023 rutschte das Unternehmen jedoch in die Insolvenz. „Wir haben vor Corona stark in unser Wachstum investiert, das auch über die Erweiterung unseres Sortiments erfolgen sollte. Daher haben wir viel Geld in neue Vertriebspartner und auch neue Marken gesteckt.” Dann kam alles zusammen: Corona, Inflation, hohe Energiekosten und der Ukraine-Krieg. „All diese Faktoren haben ein Schäufelchen zu unserem Grab beigetragen”, so Abermann, die dennoch betont: „Ich will nicht alles auf die wirtschaftlichen Umstände schieben. Wir haben das große Ganze einfach nicht richtig eingeschätzt.” Als ihr Traum, eine Alternative zu dem „überzuckerten Getränkemarkt” zu schaffen, in die Brüche ging, fühlte sie sich auch persönlich betroffen und schuldig. „Da waren langjährige Partner, die wir nicht mehr zahlen konnten. Wir hatten das Gefühl, alle im Stich zu lassen. Da ging alles in die Brüche.” Die Insolvenz sei „ein Weg, den du nicht gehen willst. Aber ich wusste ganz sicher, dass ich noch nicht fertig bin und dass es weiter geht.” Ende 2023 erhielt sie eine zweite Chance. Im Zuge des Konkursverfahrens kam es zu einem Asset-Deal (Anm: Form eines Unternehmenskaufs). Abermann beschreibt den Neustart als „Möglichkeit, die man im Leben normalerweise nicht zweimal bekommt”. Mit ihrem Geschäftspartner möchte sie nun gemeinsam Strukturen nutzen. „Ich möchte das Thema Scheitern keinesfalls glorifizieren. Aber es ist gut und wichtig, dass es thematisiert wird- mit der Möglichkeit für viele Unternehmen, eine zweite Chance zu bekommen.”
Enttabuisieren von Misserfolgen
„Die Leute müssen verstehen, dass Scheitern dazu gehört, auch zum Unternehmertum. Und wer nicht gescheitert ist, hat wohl auch noch nie etwas Neues probiert”, sagt Francis Rafal. Der 33-Jährige gründete bisher bereits fünf Unternehmen – das erste mit 19 Jahren -, wobei eines durch eine Verkettung mehrerer Umstände in die Brüche ging, darunter Auftragseinbrüche, Zahlungsausfälle und Fehler in der Finanzplanung. Das Ergebnis waren jede Menge Schulden, ein Burn-out und viel harte Arbeit, bis die Firma schließlich liquidiert werden konnte. Freunden und Familie erzählte Rafal erst sehr spät von seinen Tiefschlägen. „Ich habe mich geschämt, ihnen zu erzählen, was los ist. Denn zu scheitern war einfach keine Option für mich”, so Rafal: „Eine Kultur des Scheiterns hätte es mir zumindest einfacher gemacht, denn bisher galt für mich: Wenn das Unternehmen nicht erfolgreich ist, ist dein Leben quasi vorbei.” Vor gut einem Jahr wagte Rafal jedoch wieder den Sprung in die Selbstständigkeit und gründete mit vier Partnern ein neues Unternehmen. Ein KI-Start-up, das Betriebe dabei unterstützt, Künstliche Intelligenz in ihre Systeme zu integrieren, etwa um die Lesbarkeit von Dokumenten leichter zu machen.
Transparenz & persönliche Haltung
Doch was hat Rafal aus dem Fehlschlag gelernt? „Man braucht absolute Transparenz innerhalb des Unternehmens, damit alle wissen, woran man arbeitet und wo die Firma steht“, ist Rafal überzeugt. So bleibe man handlungsfähig und könne besser entscheiden, was als nächstes zu tun sei. Zudem gibt es wöchentliche Liquiditätsplanungen mitsamt Abgleichungen des Bankkontos hinsichtlich Zahlungen. Auch persönlich zog er seine Lehren daraus: „Ich hatte eine große Identifikation von mir als Person mit meiner Firma, was ich jetzt nicht mehr so sehe. Ich arbeite an der Firma und versuche, die erfolgreich zu machen, aber ich bin nicht die Firma.” Stark verändert hat sich auch sein Zugang zu Fehlschlägen. „99 Prozent der Start-ups scheitern. Es kann sein, dass dieses neue Unternehmen eben auch nicht aufgeht – auch wenn man, so wie ich gerade, an die Idee glaubt.”
Gründerfreundlicheres Umfeld
Welche Rahmenbedingungen bräuchte es, um Österreich gründerfreundlicher zu machen? Dazu Schmidgruber: „Österreich bietet zwar unheimlich Förderungen, aber bei den Investments in Unternehmen hinken wir dramatisch hinterher”, so der JWW-Vorsitzende, der übrigens auch selbst Start-up-Gründer ist. Der im Regierungsprogramm angekündigte Dachfonds ist für Schmidgruber ein guter erster Schritt. „Noch wichtiger wäre meines Erachtens aber die Einführung eines Beteiligungsfreibetrags, wie ihn Junge Wirtschaft und Wirtschaftskammer seit Jahren fordern”, ergänzt Schmidgruber. Denn ein solcher würde mehr privates Kapital mobilisieren und käme dem Staatshaushalt obendrein wesentlich günstiger als direkte Förderungen. „Unternehmerisches Scheitern ist nach wie vor stigmatisiert. Das ist falsch, weil es Mut nimmt, weil es hemmt”, gibt Walter Ruck abschließend zu bedenken. Denn ist eine Insolvenz gleichbedeutend mit dem Ende der unternehmerischen Tätigkeit, bleiben Ideen auf der Strecke, die für Wirtschaft und Gesellschaft womöglich von Nutzen hätten sein können.